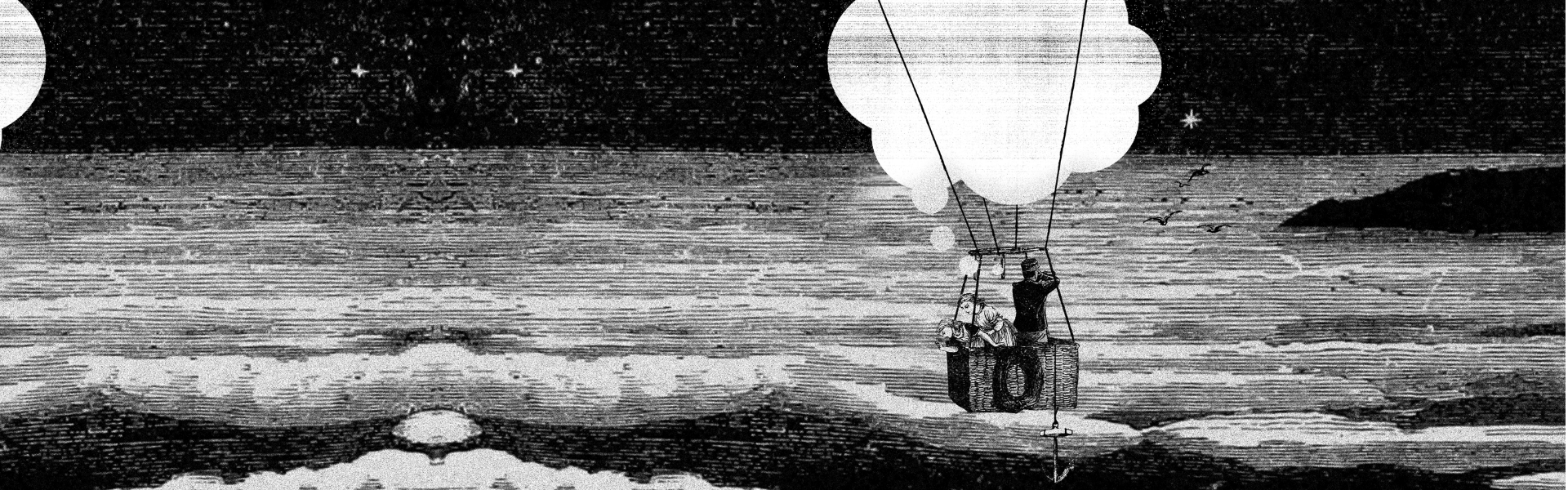Gemeinsam Krisen lösen: #WirVsVirus, ein Beispiel für soziale Innovation
Von Prof. Johanna Mair, Dozentin für Leadership und soziale Innovation &
Prof. Dr. Thomas Gegenhuber, Dozent für digitale Transformation und BWL
Die COVID-19-Krise fordert die Gesellschaft heraus und ruft nach sozialer Innovation: nach neuen und wertvollen Produkten, Dienstleistungen und Praktiken, nach neuen Wegen zur Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Aber wie lassen sich diese entdecken? Ein Beispiel dafür ist das offene und partizipative Format des #WirVsVirus-Hackathons.
Was ist ein Hackathon? Der Begriff Hackathon hat seinen Ursprung in der Tech-Szene und beschreibt einen zeitlich fokussierten, kollaborativen Wettbewerb, der neue technische Lösungen entwickeln soll, beispielsweise eine neue App. Dieses zunehmend beliebte Format wurde auch mit #WirVsVirus umgesetzt: Die OrganisatorInnen veröffentlichten zum Höhepunkt der COVID-19-Krise im März einen Aufruf zur Lösung von Problemen, die durch die Krise verursacht wurden. Insgesamt rund 28.000 TeilnehmerInnen folgten diesem Aufruf, organisierten sich selbst in Teams und entwickelten dann vom 20. bis zum 22. März erste Prototypen, beispielsweise für die Digitalisierung von Prozessen im Gesundheitssystem (siehe auch https://wirvsvirus.org). Soziale Innovation als Prozess, der von der Idee bis zur Umsetzung und Wirkung führt, ist allerdings kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Im Rahmen von #WirVsVirus wurden 130 Teams durch ein Umsetzungsprogramm dabei unterstützt, ihre Ideen weiterzuentwickeln und zu skalieren. Instrumente des Unterstützungsprogramms waren unter anderem Networking-Möglichkeiten mit ExpertInnen, wöchentliche Calls für Wissensaustausch und Community Building, Themen-Calls zur Know-how-Vermittlung und eine digitale Plattform, mit deren Hilfe die Teams Ressourcen von unterstützenden Unternehmen erfragen konnten, beispielsweise Rechtsberatung. Mit diesem Umsetzungsprogramm unterscheidet sich #WirVsVirus von anderen Hackathons, in denen zwar Ideen und Prototypen entstehen, anschließend aber keine Strukturen aufgebaut werden, um die Ideen auch zu implementieren. Neben staatlicher Förderung (Bundeskanzleramt, BMBF, KfW-Stiftung) wurde das Unterstützungsprogramm auch durch Unternehmen und deren Stiftungen finanziert, unter anderem von der Vodafone Stiftung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Hackathons war #WirVsVirus in mehrfacher Hinsicht vielfältig: Erstens begeisterte der Hackathon Personen jenseits der männlich dominierten Start-up- und Tech-Szene. ArbeitnehmerInnen aus Profit- und Non-Profit-Organisationen, Studierende, WissenschaftlerInnen und andere wollten ihren Beitrag zur Krisenbewältigung leisten. Es wurden, zweitens, vielfältige Arten von Lösungen entwickelt: etwa Chat-Bots, die bei Förderanträgen helfen, Software zur Digitalisierung des Corona-Managements in Gesundheitsämtern oder die Vernetzung von Studierenden mit SchülerInnen, die Lern- und Nachhilfe suchen. Allein diese drei Beispiele zeigen bereits, dass die gefundenen Lösungen über die Zeit der Krise hinaus wirken und soziale Systeme nachhaltig verändern können.
Möglich war diese Vielfalt wegen der offenen und partizipativen Ausrichtung des Formats. Jede und jeder konnte an dem Hackathon teilnehmen. Für die Auswahl der zu lösenden Probleme wurde der Input sowohl von Ministerien als auch aus der Zivilgesellschaft gesucht. Im Unterstützungsprogramm wurden PatInnen mit Expertise aus vielen gesellschaftlichen Bereichen gewonnen. Schließlich wurden technologische Tools gewählt (beispielsweise Slack oder Devpost), die transparente Kommunikationsprozesse zwischen OrganisatorInnen und TeilnehmerInnen ermöglichten. Insgesamt unterstrichen der Hackathon und das Umsetzungsprogramm die demokratiepolitische Bedeutung des „digitalen Ehrenamts“. Dieses bietet eine Möglichkeit der Teilhabe von BürgerInnen durch gestaltendes Handeln und ist damit eine sinnvolle Ergänzung der demokratischen Teilhabe durch Stimmabgabe.
Offene und partizipative Prozesse so zu organisieren, dass sie einen hohen Inklusivitätsgrad aufweisen, bleibt eine Herausforderung. Die Diversität der TeilnehmerInnen am Hackathon und im Umsetzungsprogramm spiegelt nicht die Diversität der deutschen Gesellschaft wider. Auch die Jurys, welche die Hackathon-Projekte und die Bewerbungen für das Umsetzungsprogramm evaluierten, hätten von mehr Vielfalt der fachlichen Ausrichtung sowie des soziodemografischen Hintergrunds profitiert. Schließlich stellt sich auch die Frage, wer sich monatelanges Engagement nach dem Hackathon leisten kann. Die technologischen Tools haben den Hackathon einerseits erst möglich gemacht, anderseits können sie von jenen als Barriere empfunden werden, die mit ihnen nicht vertraut sind. Schließlich stellt sich die Frage, welche Sprache für derartige Projekte gewählt wird: Eine Konzentration auf das Deutsche schließt in Deutschland lebende Talente anderer Herkunft eher aus, Englisch als Arbeitssprache kann wiederum von anderen TeilnehmerInnen als Hürde wahrgenommen werden. Das illustriert, dass jede Designentscheidung eines offenen und partizipativen Prozesses Trade-offs einschließt. Darüber hinaus brauchen partizipative Formate auch Geschlossenheit: Ohne ein sehr strukturiertes Organisationsteam, dessen Governance-Ansatz die Top-down-Koordinierung mit Bottom-up-Selbstorganisation verknüpfte, wäre dieses Format nicht möglich gewesen. Denn wenn jede Entscheidung mit allen TeilnehmerInnen hätte abgestimmt werden müssen, wäre das Format zu behäbig gewesen, um effektiv operieren zu können. Der Hackathon und das Umsetzungsprogramm haben bereits zu getesteten und funktionierenden Lösungen geführt. #WirVsVirus-Teams sind durch das Umsetzungsprogramm in Kontakt mit Innovatoren in öffentlichen Institutionen gekommen und konnten ihre Lösungen mit Gesundheitsämtern oder lokalen Wohlfahrtsverbandsorganisationen testen. Aber damit soziale Innovation Wirkung erzielt, müssen die Lösungen auch „auf die Straße gebracht werden“: Sie müssen skaliert, repliziert und weit gestreut werden. Diese Brücke zwischen Lösung und Wirkung können Innovatoren nicht allein bauen. Derzeit mangelt es noch an einer entsprechenden Implementierungskultur, -kompetenzen und -ressourcen.
Was kann getan werden, um diese systemischen Schwachstellen zu beseitigen? Ein zentrales Element eines solchen Kulturwandels wäre die öffentliche Anerkennung der Tatsache, dass Bürger InnovatorInnen professionelle Lösungen entwickeln können. Wir sehen darin eine Aufgabe der Politik und der Medien: Sie sollten InnovatorInnen in der Verwaltung und in Non-Profit-Organisationen herausstellen, die Mut gezeigt haben, über die eigene Organisationslogik hinauszuschauen und Wege durch den bürokratischen Dschungel zu ebnen, um BürgerInnen-Lösungen zu skalieren. Schließlich braucht es auch eine Verbesserung von Förderprogrammen sowie die Generierung von Fremdkapital entlang des Prozesses von Innovation und Skalierung. Der Staat sollte außerdem Anreize für die potenziellen TeilnehmerInnen derartiger Prozesse schaffen. Es ließe sich beispielsweise an eine Erweiterung des freiwilligen Sozialjahrs zu einem Innovationsjahr denken, an steuerliche Vorteile oder die Vergabe von sozialen InnovatorInnenstipendien für bereits berufserfahrene Personen. Finanziert werden könnte diese Politik beispielsweise durch die Zweckwidmung von nachrichtenlosen Finanzwerten in Deutschland, deren Gesamtbetrag auf zwei bis neun Milliarden Euro geschätzt wird. Das Format des Hackathons mitsamt seinem Umsetzungsprogramm hat sich im Fall von #WirVsVirus bewährt und ist eine Blaupause für künftige Initiativen dieser Art. Dieses Format zeigt, was möglich ist. Sie ist aber noch nicht die soziale Innovation selbst. Diese setzt vor allem voraus, die jeweils Betroffenen in den Prozess zu integrieren, der von der Idee bis hin zur nachhaltigen Umsetzung reicht.